
Kondensatortypen
 | Kondensatortypen |
AllgemeinesEin Kondensator besteht aus zwei Metallplatten oder -folien, die sich isoliert voneinander in einem relativ geringen Abstand gegenüberstehen. Als Isoliermaterial werden oft Materialien wie spezielles Papier, Kunststoffolien oder Keramik verwendet. Nachfolgend wird beschrieben, um welche Materialien es sich genau handelt und wie übliche Kondensatoren in der Praxis aufgebaut sind. Wenn es Sie interessiert, wie ein Kondensator funktioniert, können Sie dies im DokumentAufbau von KondensatorenZwei sich gegenüberstehende Metallplatten ergeben wie inKondensatoren mit aufgedampften Elektroden haben den Vorteil, daß sie selbstheilend sind: Im Falle eines Spannungsdurchschlags durch das Dielektrikum infolge Überspannung verbrennt der durch den Überschlag hervorgerufene kleine Funke das Dielektrikum an der Durchschlagstelle, wodurch ein kleines Loch entsteht. Durch die hohe Stromdichte um die Durchschlagstelle herum wird die elektrisch leitfähige Metallschicht in diesem Bereich dank ihrer geringen Dicke weggebrannt, so daß sich die Elektroden nicht berühren und es damit nicht zum Kurzschluß kommt. Der Kondensator büßt zwar bei jedem Durchschlag einen geringen Teil seiner Kapazität ein, bleibt aber funktionstüchtig. Kondensatoren mit Film-Folie-Aufbau sind zwar oft nicht selbstheilend, haben aber den Vorteil, daß sie für höhere Ströme geeignet sind, weil Metallfolien dicker als aufgedampfte Metallschichten sind und damit eine höhere Stromtragfähigkeit besitzen. Wenn man auf diese Weise einen sehr dünnen Folienkondensator hergestellt hat, stört jedoch die große Grundfläche. Diese kann man sehr leicht extrem stark verringern, indem man die metallisierte Folie einfach aufwickelt. Damit sich dabei die beiden "Platten" nicht berühren, wird eine Seite mit einer zusätzlichen Isolierfolie versehen. Als positiver Nebeneffekt ergibt sich unter der Voraussetzung, daß die beiden Folien aus dem gleichen Material und gleich dick sind, eine Kapazitätsverdopplung, da jede "Platte" nicht nur einen Gegenpart besitzt, sondern gleich zwei Der so aufgebaute Kondensator hat nur noch einen Nachteil: Die aufgerollte Metallfolie wirkt wie eine Spule mit vielen Windungen und besitzt daher eine recht hohe Induktivität, was die Hochfrequenzeigenschaften stark negativ beeinflußt. Diesen Effekt kann man nahezu beseitigen, indem man die Folien jeweils an den Stirnseiten kontaktiert. Dadurch werden nämlich alle Windungen gegeneinander kurzgeschlossen und können induktiv nicht wirksam werden. KondensatortypenKondensatoren unterscheiden sich nicht nur durch die Bauform sondern auch durch die verwendeten Materialien. Nachfolgend werden einige bekannte und verbreitete, z.T. auch historische Bauformen vorgestellt.PapierkondensatorenWie der Name schon vermuten läßt, wird als Dielektrikum bei Papierkondensatoren Papier zum Einsatz. Papier sprich gepreßte Zellulose ist im trockenen Zustand ein recht guter Isolator und war eines der ersten verwendeten Dielektrika, die in industriell hergestellten Kondensatoren verwendet wurde. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Schreibpapier sondern um speziell behandeltes (d.h. impägniertes) Papier.Ein großer Nachteil von Papierkondensatoren ist, daß Papier einen geringe Proportionalitätskonstante εr besitzt und im Laufe der Zeit auch seine Dicke verändert, was sich in einer Kapazitätsänderung äußert. Außerdem ist Papier deutlich weniger durchschlagfest als eine gleichdicke Kunststoffolie. Dies hat eine ziemlich große Bauform zufolge. Hinzu kommt, daß durch die nicht zu unterschätzenden elektrostatischen Kräfte zwischen den Metallfolien das Papier zusammengequetscht wird. Die Dicke des Papiers nimmt deshalb mit wachsender Spannung geringfügig ab, weshalb seine Kapazität ein wenig ansteigt. Da das Zusammendrücken ein in gewissem Rahmen reversibler Prozeß ist, ergibt sich eine Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung. Abgesehen davon wirken die sich minimal bewegenden Metallfolien wie die Membran eines Lautsprechers. Besonders bei hohen Spannungen und schnellem Ladungswechsel entstehen deshalb hörbare Geräusche. Aufgrund der bewegten Massen ergibt sich eine relativ niedrige akustische Resonanzfrequenz. Die Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung ist damit zusätzlich auch noch frequenzabhängig. Aufgrund dieser Nachteile werden Papierkondensatoren kaum noch verwendet. ÖlpapierkondensatorenBei den als Ölpapierkondensatoren bezeichneten Kondensatoren (in HiFi-Kreisen gern auch Oilers genannt) handelt es sich um Papierkondensatoren, bei denen das isolierende Papier mit speziellem Öl getränkt ist. Ölpapierkondensatoren besitzen immer Metallfolien als Elektroden, weil sich auf öliges Papier keine Metallschichten aufdampfen lassen. Das Papier dient dabei eigentlich nur als Abstandhalter für die Folien, wobei das Öl im Idealfall sämtliche Hohlräume im Papier ausfüllt und als Dielektrikum wirkt. Im Vergleich zu normalem Kondensatorpapier besitzt ölgetränktes Papier eine etwas höhere Proportionalitätskonstante εr und bei gleicher Papierdicke oft eine höhere Spannungsfestigkeit. Die eigentlich dadurch mögliche kleinere Bauform wird jedoch oft dadurch verspielt, daß oft der Kondensatorwickel in einem ölgefüllten Gehäuse schwimmt, was die Bauform vergrößert. Bei in der Hochspannungstechnik verwendeten größeren Exemplaren kann man das Öl manchmal sogar wechseln. Dieses Spezialöl besitzt viele z.B. flammhemmende Zusatzstoffe, die zumindest bei älteren Exemplaren hochgradig gesundheitsschädlich sind.Die Vorteile und Nachteile von Ölpapierkondensatoren sind weitgehend identisch mit denen von Papierkondensatoren, da es sich lediglich um eine spezielle Variante von Papierkondensatoren handelt. Bei Ölpapierkondensatoren verwendet man allerdings vorzugsweise Papier mit vielen großen Hohlräumen, damit viel Platz für das Öl vorhanden ist. Papier mit vielen großen Poren ist noch weniger druckstabil als solches mit wenigen kleinen, so daß die Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung bei Ölpapierkondensatoren etwas größer als bei Papierkondensatoren ist. Außer in der Hochspannungs-/Starkstromtechnik werden Ölpapierkondensatoren nicht mehr verwendet. MetallpapierkondensatorenAls Dielektrikum kommt bei Metallpapierkondensatoren ebenfalls Papier zum Einsatz. Auf dieses Papier werden als Elektroden dünne Metallschichten aufgedampft. Metallpapierkondensatoren sind deshalb selbstheilend und besitzen außerdem eine kleinere Bauform als Papierkondensatoren, weil aufgedampfte Metallschichten viel dünner als Metallfolien sind. Ansonsten entsprechen ihre Eigenschaften denen der Papierkondensatoren.KunststoffolienkondensatorenAls Dielektrikum wird bei Kunststoffolienkondensatoren dem Namen entsprechend eine Kunststoffolie verwendet. Kunststoffe besitzen eine erheblich größere Durchschlagfestigkeit als Papier, so daß bei gleicher Nennspannung infolge der dünneren Folie eine deutlich kleinere Bauform möglich ist. Da zudem Kunststoffolie ganz erheblich druckstabiler als Papier ist, ist die Kapazität unabhängig von der angelegten Spannung. Bei Kunststoffolienkondensatoren werden sowohl durch eine Kunststoffolie voneinander isolierte Metallfolien (Film-/Folienaufbau) als auch metallisierte Kunststoffolien (MK-Aufbau, MK = Metallisierter Kunststoff) verwendet. Die aufgedampfte Metallisierung ist mit nur einigen zig Nanometer Dicke viel dünner als eine Metallfolie, die einige Mikrometer dick ist (Nanometer = Milliardstel Meter, Mikrometer = Millionstel Meter). MK-Kondensatoren sind daher nochmals kleiner als Kondensatoren mit Film-/Folienaufbau. Ihr einziger Nachteil ist, daß die dünne Metallschicht eine geringere Stromtragfähigkeit besitzt als vergleichsweise dicke Folien. Für Impulsanwendungen, bei denen oft kurzzeitig Ströme von etlichen hundert Ampere oder noch mehr fließen, verwendet man vorzugsweise Kondensatoren mit Film-/Folienaufbau. MK-Kondensatoren haben hingegen den Vorteil, selbstheilend zu sein.Es gibt zahlreiche verschiedene Kunststoffarten, die als Dielektrikum Verwendung finden, wobei jeder Kunststoff materialabhängige Vor- und Nachteile besitzt. In den allermeisten Fällen ist ein simpler Wald-und-Wiesen-MK-Kondensator mehr als ausreichend. Wo ganz spezielle Anforderungen bestehen (z.B. Hochspannungstechnik oder Meßtechnik), bietet jedoch die große Vielfalt an Kunststoffen die Möglichkeit, den für die jeweilige Anwendung besten Kondensator zu verwenden. Unterschiede gibt es beispielsweise bei der Temperaturabhängigkeit und dem Langzeitverhalten (beide wirken sich auf die Kapazitätstoleranz aus), bei der Durchschlagfestigkeit, der Höhe der Permittivitätszahl, des Isolationswiderstands und den dielektrischen Verlusten. Gängige Kondensatoren werden aus den nachfolgenden Kunststoffen hergestellt, die mit Vor- und Nachteilen aufgelistet sind:
Kunststoffolienkondensatoren werden in einem sehr breiten Kapazitätsbereich hergestellt, sind aufgrund ihrer sehr guten Eigenschaften für die meistens Anwendungen bestens geeignet und zudem relativ preiswert. Es ist deshalb kein Wunder, daß sie die meistverwendete Kondensatorbauform sind. KeramikkondensatorenBei Keramikkondensatoren kommen als Dielektrikum spezielle Keramiken zum Einsatz. Denken Sie bei Keramik aber bitte nicht an Tafelgeschirr. Es handelt sich vielmehr um bestimmte chemische Verbindungen, die unter Druck und Temperatur gesintert werden. Wenn man ein kleines Keramikrohr innen wie außen metallisiert und die Metallisierung der Innen- und der Außenseite an getrennte Anschlüsse führt, erhält man einen sogenannten Rohrkondensator. Seine Kapazität ist aufgrund der geringen Fläche und der relativ großen Dicke der Rohrwandung ziemlich gering. Als Ausgleich besitzt er jedoch gute Hochfrequenzeigenschaften. Heutzutage verwendet man jedoch fast ausschließlich Keramikkondensatoren, die aus einem rechteckförmigen Plättchen oder einer runden Scheibe bestehen, die auf beiden Seiten metallisiert ist. Durch Verwendung spezieller Keramiken kann man in Anbetracht der geringen Fläche und des im Vergleich zu einer Kunststoffolie dicken Dielektrikums erstaunlich hohe Kapazitätswerte erzielen.Man unterscheidet grob zwischen Dielektrika der Gruppe I und II. Dielektrika der Keramikkondensatoren mit Dielektrika der Gruppe II besitzen eine deutlich höhere dielektrische Absorption. Diese ist umso höher, je größer die Dielektrizitätskostante (neuerdings "relative Permittivitätskonstante" genannt) der verwendeten Keramik ist. Sie sind zwar für Schwingkreise etc. weniger gut geeignet aber wie geschaffen für Sieb- und Entkopplungszwecke. Hierbei spielt es auch keine Rolle, daß die Temperaturabhängigkeit mit größer werdender Dielektrizitätskostante zunimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 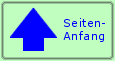 |
Alle Angaben in Zusammenhang mit dieser Site wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Trotzdem kann hierfür keine Haftung übernommen werden. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Chr. Caspari (sofern nicht anders gekennzeichnet). Es gelten die allgemeinen Mitteilungen über Fehler sind stets willkommen (Kontaktmöglichkeiten siehe Letztes Update dieser Seite: 01.10.2023 (Untergeordnete Seiten können aktueller sein) |