
Elektrogitarren
 | Elektrogitarren |
AllgemeinesDie Elektrogitarre hat in den 50er und 60er Jahren Klänge möglich gemacht, die man von einer normalen akustischen Gitarre überhaupt nicht kannte und die im Zusammenhang mit übersteuerten Verstärkern Wegbereiter für die Entwicklung der modernen Rock- und Popmusik war. Heutzutage sind E-Gitarren aus der Musik überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in einer nahezu unüberschaubaren Vielfalt von Formen, Farben und auch mit unterschiedlicher Technik zu kaufen, und besonders als Anfänger steht man wie der Ochse vorm Berg. Elektrogitarre hat in den 50er und 60er Jahren Klänge möglich gemacht, die man von einer normalen akustischen Gitarre überhaupt nicht kannte und die im Zusammenhang mit übersteuerten Verstärkern Wegbereiter für die Entwicklung der modernen Rock- und Popmusik war. Heutzutage sind E-Gitarren aus der Musik überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in einer nahezu unüberschaubaren Vielfalt von Formen, Farben und auch mit unterschiedlicher Technik zu kaufen, und besonders als Anfänger steht man wie der Ochse vorm Berg.Obwohl E-Gitarren schon seit mehr als einem halben Jahrhundert in größerem Umfang verwendet werden, umgibt sie immer noch ein mystischer Schleier. In Musikerkreisen genießt die Elektrogitarre den Ruf eines undurchschaubaren High-Tech-Instruments, von dem keiner so recht weiß, wie der spezielle Sound der verschiedenen Modelle zustande kommt, zumal man mit einiger Übung bekannte Gitarristen nicht nur an der Spielweise sondern oft genug auch an ihrem typischen Sound erkennen kann. Dementsprechend gibt es zahlreiche Mythen und Legenden, welche Faktoren den entsprechenden Klang ausmachen. Zwecks Entzauberung dieser Mythen und Legenden können Sie nachfolgend erfahren, wie eine E-Gitarre und speziell deren Tonabnehmer funktionieren, welche Faktoren wirklich Einfluß auf den Klang haben und welche nicht. Historie der ElektrogitarreBis Mitte der 30er Jahre kannte man ausschließlich akustische Gitarren, wie sie auch heute noch gebräuchlich sind, obwohl man schon Anfang der 20er Jahre nach Möglichkeiten suchte, Gitarren lauter zu machen. Der rein passiven Möglichkeit d.h. Vergrößerung des Volumens des Korpus sind Grenzen gesetzt, weshalb nur eine aktive sprich elektrische Verstärkung erfolgversprechend war. Mikrofone nehmen allerdings auch Störgeräusche auf und neigen zu Rückkopplungen, weshalb man auf die Idee kam, die Schwingungen der Saiten direkt am Entstehungsort abzugreifen. George Beauchamp und Adolf Rickenbacker entwickelten Anfang der 30er Jahre einen Tonabnehmer, der aus einem Magneten bestand, um den derum eine Spule gewickelt war. Die schwingenden ferromagnetischen Saiten ändern hierbei geringfügig die Stärke des Magnetfelds, so daß in der Wicklung im Takte der Saitenschwingung eine Spannung induziert wird, die man auf einen Verstärker führen kann. Der Tonabnehmer und mit ihm die elektrische Gitarre war geboren. Der Vorteil eines solchen Tonabnehmers ist, daß er nur auf die Bewegung von ferromagnetischem Material (d.h. die Schwingung der Saiten) reagiert und keine anderen Störgeräusche aufnimmt (außer dem allgegenwärtigen Netzbrummen). Die damit ausgerüstete Gitarre, die keinen Resonanzkörper besaß und wegen ihrer extrem unkonventionellen Form "Bratpfanne" genannt wurde, war ab Mitte der 30er Jahre auf dem Markt verfügbar, blieb aber ein Exot. Ungefähr zur gleichen Zeit erschienen mehrere elektrifizierte Gitarren der Firma Gibson. Es handelte sich um akustische Gitarren mit recht voluminösem Korpus, so daß sich auch ohne Verstärkung ein lauter Ton ergab. Da es sich nur um eine Erweiterung einer akustischen Gitarre um einen Tonabnehmer handelt, konnte man sie problemlos auch in der althergebrachten Weise ohne elektrische Verstärkung verwenden. Mitte der 30er Jahre kannte man ausschließlich akustische Gitarren, wie sie auch heute noch gebräuchlich sind, obwohl man schon Anfang der 20er Jahre nach Möglichkeiten suchte, Gitarren lauter zu machen. Der rein passiven Möglichkeit d.h. Vergrößerung des Volumens des Korpus sind Grenzen gesetzt, weshalb nur eine aktive sprich elektrische Verstärkung erfolgversprechend war. Mikrofone nehmen allerdings auch Störgeräusche auf und neigen zu Rückkopplungen, weshalb man auf die Idee kam, die Schwingungen der Saiten direkt am Entstehungsort abzugreifen. George Beauchamp und Adolf Rickenbacker entwickelten Anfang der 30er Jahre einen Tonabnehmer, der aus einem Magneten bestand, um den derum eine Spule gewickelt war. Die schwingenden ferromagnetischen Saiten ändern hierbei geringfügig die Stärke des Magnetfelds, so daß in der Wicklung im Takte der Saitenschwingung eine Spannung induziert wird, die man auf einen Verstärker führen kann. Der Tonabnehmer und mit ihm die elektrische Gitarre war geboren. Der Vorteil eines solchen Tonabnehmers ist, daß er nur auf die Bewegung von ferromagnetischem Material (d.h. die Schwingung der Saiten) reagiert und keine anderen Störgeräusche aufnimmt (außer dem allgegenwärtigen Netzbrummen). Die damit ausgerüstete Gitarre, die keinen Resonanzkörper besaß und wegen ihrer extrem unkonventionellen Form "Bratpfanne" genannt wurde, war ab Mitte der 30er Jahre auf dem Markt verfügbar, blieb aber ein Exot. Ungefähr zur gleichen Zeit erschienen mehrere elektrifizierte Gitarren der Firma Gibson. Es handelte sich um akustische Gitarren mit recht voluminösem Korpus, so daß sich auch ohne Verstärkung ein lauter Ton ergab. Da es sich nur um eine Erweiterung einer akustischen Gitarre um einen Tonabnehmer handelt, konnte man sie problemlos auch in der althergebrachten Weise ohne elektrische Verstärkung verwenden.Der nächste Schritt kam von einem gewissen Leo Fender, der eine Gitarre konstruierte, die keinen Resonanzkörper besaß sondern nur ein Stück Brett. Diese erschien 1948 als Broadcaster. Im Gegensatz zur "Bratpfanne" war ihre Form jedoch an die damals üblichen akustischen Gitarren angelehnt und damit erheblich kundenfähiger als diese. 2 Jahre später wurde sie aus Gründen des Markenrechts in Telecaster umbenannt. Diese Brettgitarre erlangte schon bald Weltruf. Es folgte 1954 der Knaller in der Historie der Elektrogitarren, der wohl wirklich auch dem unkundigsten Hörer von Pop- und Rockmusik bekannt sein dürfte: Die legendäre Stratocaster, die zudem die erste kommerziell erhältliche E-Gitarre mit Vibratohebel war (auch umgangssprachlich Jammerhaken oder fälschlicherweise Tremolo genannt). Die Firma Gibson sah sich durch den Newcomer Fender in Zugzwang und brachte 1952 als Antwort auf die innovative Fender Telecaster mit der Les Paul die erste Solid-Body-Gitarre von Gibson auf den Markt, damals noch mit Single-Coil-Tonabnehmern. Die berühmten, von Seth Lover entwickelten Humbucker (dazu später), die unempfindlich gegenüber dem allgegenwärtigen Netzbrummen waren, kamen erst ab 1957 in der Les Paul zum Einsatz. Kleine Anekdote am Rande: Der Name PAF, unter dem diese Tonabnehmer heute bekannt sind, ist nichts anderes als die Abkürzung für "Patent Applied For", also "Patent beantragt", d.h. einem Aufdruck, der nur davor warnen sollte, Kopien herzustellen. Zwar hatten im Laufe der Jahre nicht nur diese Firmen zahlreiche neue Modelle aufgelegt, aber den fantastischen Erfolg der o.g. 3 Modelle konnte keine andere Elektrogitarre wiederholen. Man kann sie nicht nur auch heute noch kaufen, vielmehr teilen sich insbesondere die Stratocaster und die Les Paul inklusive der zahlreichen Nachbauten oder Abwandlungen anderer Firmen stückzahlmäßig fast den kompletten Markt. Mechanischer Aufbau einer ElektrogitarreGrob gesagt besteht eine Solid-Body-Gitarre aus einem Brett, das eine nahezu beliebige Kontur besitzen kann. Darauf aufgeschraubt ist der Steg, über den die Saiten laufen. Zusätzlich ist ein Saitenhalter vorhanden, der auch in den Steg integriert sein kann. An dieses Brett, den Korpus, angeschraubt (z.B. Stratocaster) oder in dieses Brett eingeleimt (z.B. Les Paul) ist der Hals, an dem meistens auch die Mechaniken zum Stimmen der Saiten angebracht sind. Bei manchen Gitarren geht der Hals auch durch (entweder ganz durch den Korpus oder seltener nur bis zum Steg), wovon man sich einen länger anhaltenden Ton (Sustain) verspricht. Im Vergleich zu frühen, schlampig eingeschraubten Hälsen mag dies zutreffen, aber im Vergleich zu einem handwerklich korrekt eingeleimten Hals ist zumindest von der Theorie her bei sonst gleichen Rahmenbedingungen kein Unterschied zu erwarten, da eine gute Klebestelle eine höhere Festigkeit und geringere Dämpfung besitzt als Holz. Auch die heutige Qualität der Verschraubung gibt keinen Anlaß mehr zur Kritik bezüglich Sustainverschlechterung. Da es sich aber dem ersten Anschein nach plausibel anhört, wurden Gitarren mit durchgehendem Hals für mehr Geld verkauft als mit verschraubtem oder eingeleimtem. Heutzutage sind Gitarren mit durchgehendem Hals wieder selten geworden; am ehesten wird man noch bei Baßgitarren fündig. Zwischen Steg und Hals sind meistens zwischen ein und drei Tonabnehmer angebracht, entweder auf einer Trägerplatte befestigt (z.B. Stratocaster), die gleichzeitig auch als Schlagbrett dient, oder aber von vorne direkt auf dem Holz montiert (z.B. Les Paul).Tonabnehmer (Pickup)Hier wird mal wieder deutlich, wie eine gute Werbeabteilung aus ein paar simplen Magneten und ein wenig Kupferdraht ein Mysterium macht: Sämtliche Gitarrentonabnehmer sind recht ähnlich aufgebaut. Im Prinzip muß man nur einen Stabmagneten mit Kupferdraht bewickeln und hat schon einen Tonabnehmer für eine einzige Saite. Statt 6 einzelne Tonabnehmer zu verwenden, nimmt man aus Gründen der Materialersparnis und auch aus Platzgründen (Wickelraum) oft sechs Stabmagnete und wickelt um diese gemeinsam eine einzige Spule, wobei eine Papp- oder Kunststoffhalterung verhindert, daß sich die Magnete und die Spule gegeneinander bewegen können. In
Alternativ zu einzelnen Stabmagneten kann man auch einen Balkenmagneten (oder deren zwei) verwenden und das Magnetfeld mit ferromagnetischen Stäben oder besser Einstellschrauben durch die Spule führen wie in Die Wirkungsweise ist folgende: Der Magnet sorgt ohne äußere Einflüsse für ein statisches magnetisches Feld. Die Spule liefert keine Ausgangsspannung, weil nur dann eine Spannung induziert wird, wenn sich das Magnetfeld ändert. Und genau dies passiert, wenn sich eine ferromagnetische Saite dicht über dem Magnetpol bewegt. Die Änderung des magnetischen Flusses ist zwar sehr gering, reicht jedoch aus, um bei einer entsprechend hohen Windungszahl eine Spannung von normalerweise einigen zig bis wenigen hundert Millivolt zu erzeugen. Falls Sie mehr erfahren möchten, wie und warum das so funktioniert, finden Sie weitere Infos unter Oft  wird damit geworben, daß in den Pick-Ups ganz spezielle Magnete, mitunter sogar aus seltenen Erden (z.B. Neodym), verwendet werden. Ganz schick sind aufgrund der Vintage-Welle die konventionellen wird damit geworben, daß in den Pick-Ups ganz spezielle Magnete, mitunter sogar aus seltenen Erden (z.B. Neodym), verwendet werden. Ganz schick sind aufgrund der Vintage-Welle die konventionellen Der große Nachteil eines solchen Tonabnehmers ist seine Anfälligkeit gegenüber niederfrequenten magnetischen Feldern, wie sie beispielsweise von Netztransformatoren und Vorschaltdrosseln von Leuchtstofflampen erzeugt werden. Zur Erinnerung: Bei sich ändernden Magnetfeldern wird in der Spule eine Spannung induziert. Daher wird auch durch diese Störfelder eine Spannung im Tonabnehmer induziert. Dies kann man leicht vermeiden, indem man folgenden Trick verwendet: Man verwendet statt eines einzigen gleich zwei Tonabnehmer und schaltet diese umgekehrt gepolt in Reihe (also hintereinander). Dies bewirkt, daß ein äußeres Magnetfeld zwar in beiden Spulen eine Spannung induziert, diese Spannungen sich aber wegen der umgekehrten Polung der Spulen gegeneinander aufheben und somit am Ausgang keine Spannung abgegeben wird. Das gleiche passiert auch mit dem Nutzsignal, was selbstverständlich unerwünscht ist. Hier kann man aber einfach Abhilfe schaffen, indem man die Polung der Magnete in einer Spule umdreht. Dadurch produziert diese Spule ein eigentlich umgekehrt gepoltes Nutzsignal, das durch die umgekehrte Polung der Spule aber wieder richtig herum gepolt ist. Somit erscheint am Ausgang eine doppelt so hohe Spannung wie bei nur einer Spule. Solche Tonabnehmer nennt man Humbucker oder "humbucking pick ups". In  Bild 3: Humbucker SoundJeder Gitarrenhersteller wirbt mit dem besonders guten Sound, den seine Gitarren erzeugen. Oft wird dies sowohl mit besonders edlen Hölzern als auch mit besonderen Eigenschaften der verwendeten Tonabnehmer begründet. Hier ist leider ziemlich viel Hokuspokus im Spiel, und eine billige Elektrogitarre muß nicht unbedingt schlechter klingen als eine teure, wobei über die Fertigungsqualität natürlich nichts gesagt ist. Letztere hat hauptsächlich Einfluß auf die Bespielbarkeit und die optische Anmutung aber kaum auf den Sound, wenn man einmal davon absieht, daß ein schlampig eingeschraubter Hals sich negativ auf das Sustain (=Länge des Ausschwingvorgangs) auswirkt und nicht polierte Bünde beim Saitenziehen ein kratzendes Geräusch produzieren. Leider gibt es Billigstgitarren, bei denen nicht nur die Fertigungsqualität überhaupt nicht stimmt, sondern die aus weichen Hölzern hergestellt werden, die man im Gitarrenbau eigentlich tunlichst vermeiden sollte. Sowas ist jedoch mittlerweile selbst im Unter-100-Euro-Segment eher selten geworden. In der Szene gibt es zahllose Gerüchte und Legenden, welche Merkmale einer Gitarre angeblich klangbestimmend sind. Diese werden nachfolgend ein wenig beleuchtet, und zwar in der Reihenfolge des oft vermuteten Einflusses.HolzEine Solid-Body-Elektrogitarre besitzt keinen Resonanzkörper. Deshalb hängt der Klang nur von dem Schwingungsverhalten der Saite selbst und den Wiedergabeeigenschaften des Tonabnehmers und der gesamten Wiedergabekette inklusive Lautsprecher und Raumakustik ab. Das Schwingungsverhalten der Saite wird wiederum in relativ geringem Umfang vom Holz beeinflußt. Ideal wäre, wenn die beiden Auflagepunkte der Saite (Steg und Bünde) unendlich steif miteinander verbunden wären, weil dann das Ausschwingverhalten der Saite nicht durch das geringe Mitschwingen der "Halterung" beeinflußt wird. Solid-Body-Elektrogitarre besitzt keinen Resonanzkörper. Deshalb hängt der Klang nur von dem Schwingungsverhalten der Saite selbst und den Wiedergabeeigenschaften des Tonabnehmers und der gesamten Wiedergabekette inklusive Lautsprecher und Raumakustik ab. Das Schwingungsverhalten der Saite wird wiederum in relativ geringem Umfang vom Holz beeinflußt. Ideal wäre, wenn die beiden Auflagepunkte der Saite (Steg und Bünde) unendlich steif miteinander verbunden wären, weil dann das Ausschwingverhalten der Saite nicht durch das geringe Mitschwingen der "Halterung" beeinflußt wird.In der Praxis gibt es aber keine unendlich steifen Materialien, so daß vor allem der relativ dünne Hals ein klein wenig mitschwingt und durch die Dämpfung des Holzes der Saite mehr oder wenig stark Energie entzieht und damit abdämpft. Im schlimmsten Fall sprich schlechter Halsauslegung kann dies zu den berüchtigten "dead spots" führen. Dead spot heißt, daß bezogen auf eine einzelne Saite der Hals so schwingt, daß auf bestimmten Bünden die Dämpfung sehr stark ist, wodurch der Ton sehr schnell abklingt; greift man die Saite einen Bund höher oder tiefer, ist das Ausklingverhalten jedoch wieder normal. Abgesehen von diesen dead spots ist die Energieentnahme durch den Hals normalerweise deutlich kleiner als die Dämpfung durch die Luft. Der Grad des Mitschwingens ist sowohl von den Materialeigenschaften und den geometrischen Abmessungen des Halses als auch von der Anregungsfrequenz, also der Schwingungsfrequenz der Saite, abhängig. Dies hat einen gewissen Einfluß auf das Ausklingverhalten d.h. die Zeit, "wie lange der Ton stehenbleibt" und auch darauf, wie stark bzw. schnell die die einzelnen Oberwellen im Laufe dieser Zeit gedämpft werden. Die Ausführung und das Material des Halses haben daher einen nennenswerten Einfluß auf das Ausschwingverhalten. Der Korpus selbst ist im Vergleich zum Hals sehr dick, weshalb das Holz des Korpus' im Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung bei Solid-Body-Elektrogitarren keinen nennenswerten Einfluß auf den Klang hat. Maßgebend für den klanglichen Einfluß ist vor allem die Dämpfung, die in erster Näherung mit der Biegesteifigkeit korreliert, in deren Wert die Korpusdicke mit der dritten Potenz Verschiedene, im Gitarrenbau übliche Harthölzer kann man klanglich nicht unterscheiden (dabei bitte keine 2 völlig unterschiedlich konstruierten Gitarren miteinander vergleichen und dann den Klangunterschied auf das Korpusholz schieben, wie es in Musikerkreisen immer gerne gemacht wird!). Insbesondere spielt eine dünne Deckschicht aus besonderem Holz wie z.B. dem beliebten Vogelaugenahorn aus klanglicher Sicht keine Rolle, macht sich aber optisch natürlich positiv bemerkbar. In der Praxis ist der Einfluß des Korpusmaterials noch geringer als in der Theorie denkbar, denn der Korpus einiger Kultgitarren besteht in der Tat aus Spanplatten. Wenn es nach dem Willen einiger selbsternannter Experten ginge, müßten solche Gitarren fürchterlich dumpf klingen. Das tun sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Wenn Sie schon relevante Einflußfaktoren suchen: Bei einer Stratocaster schwingt das obere Horn der Gitarre mehr oder minder fühlbar mit. Der Gitarre können Sie mühelos in wirklich relevantem Umfang Schwingungsenergie entziehen, indem Sie das Horn mit der Hand abdämpfen (einfach das Horn fest umgreifen). Aber können Sie dabei einen wirklichen klanglichen Unterschied wahrnehmen und sich nicht nur einreden (→ doppelter Blindversuch)? Zudem sind die Tonabnehmer der Stratocaster nicht direkt auf dem Korpus befestigt sondern auf einer nur wenige Millimeter dicken und damit nur wenig biegesteifen und zudem auch noch ziemlich schlabberigen Kunststoffplatte. Ist es nicht naheliegend, daß Auch  ist es absoluter Unsinn, daß sich der Lack bei Solid-Body-Gitarren klanglich auswirkt. Dieses nicht selten gehörte Mißverständnis geht darauf zurück, daß bei Saiteninstrumenten mit Resonanzkörper dem Lack tatsächlich sehr große Bedeutung zukommt und man dies in Unkenntnis der Sachlage auch bei Solid-Body-Gitarren annimmt. Aber bei akustischen Saiteninstrumenten ist das Holz kaum mehr als zwei Millimeter dick und wird zu einem erheblichen Teil vom Lack durchtränkt, wodurch sich die Biegesteifigkeit und damit das Schwingungsverhalten, vor allem aber das Dämpfungsverhalten sehr stark ändert. Der Lack wirkt dabei ähnlich wie Gießharz, mit dem man eine Glasfasermatte tränkt: Ohne Gießharz ist die Glasfasermatte weich und biegsam. Erst bei ausgehärtetem Gießharz wird die gewünschte Festigkeit erreicht, wobei diese deutlich vom Typ des Gießharzes abhängt. Bei mehrere Zentimeter dickem Holz spielt die dünne Lackschicht aber keine hörbare Rolle, zumal die heute bei E-Gitarren üblichen Lacke kaum ins Holz einziehen und somit der oben beschriebene Effekt nicht auftritt. ist es absoluter Unsinn, daß sich der Lack bei Solid-Body-Gitarren klanglich auswirkt. Dieses nicht selten gehörte Mißverständnis geht darauf zurück, daß bei Saiteninstrumenten mit Resonanzkörper dem Lack tatsächlich sehr große Bedeutung zukommt und man dies in Unkenntnis der Sachlage auch bei Solid-Body-Gitarren annimmt. Aber bei akustischen Saiteninstrumenten ist das Holz kaum mehr als zwei Millimeter dick und wird zu einem erheblichen Teil vom Lack durchtränkt, wodurch sich die Biegesteifigkeit und damit das Schwingungsverhalten, vor allem aber das Dämpfungsverhalten sehr stark ändert. Der Lack wirkt dabei ähnlich wie Gießharz, mit dem man eine Glasfasermatte tränkt: Ohne Gießharz ist die Glasfasermatte weich und biegsam. Erst bei ausgehärtetem Gießharz wird die gewünschte Festigkeit erreicht, wobei diese deutlich vom Typ des Gießharzes abhängt. Bei mehrere Zentimeter dickem Holz spielt die dünne Lackschicht aber keine hörbare Rolle, zumal die heute bei E-Gitarren üblichen Lacke kaum ins Holz einziehen und somit der oben beschriebene Effekt nicht auftritt.Der Hals spielt hingegen durchaus eine Rolle: Dieser ist lang und dünn und schwingt deshalb auch in nenneswertem Umfang mit. Dies ist auch dann der Fall, wenn man auf sehr hohen Bünden spielt, weil die Mechaniken bzw. der Klemmsattel das obere Widerlager darstellen. Die sich mit der Saitenschwingung leicht ändernde Zugspannung der Saiten "zerrt" daher immer am oberen Widerlager des Halses. Hier ist nicht nur das Material für das Schwingungsverhalten wichtig sondern in gewissem Umfang auch die Form. Denn ein U-förmiger Hals besteht bei gleicher Dicke aus mehr Material als ein D- oder gar V-förmiger Hals, sodaß er ein höheres Trägheitsmoment (="Biegesteifigkeit") besitzt, was indirekt eine geringere Dämpfung bedeutet. Aufgrund der geringen Gesamtdicke eines Halses spielt es auch durchaus eine Rolle, aus welchem Material das Griffbrett besteht. Denn es hat an der Gesamtdicke einen nennenswerten Anteil und reicht zudem über die gesamte Halsbreite, während der Hals auf der Rückseite ja abgerundet und damit schmäler ist. Dabei ist das heute selten gewordene Ebenholz, das übrigens eine so hohe Dichte hat, daß es in Wasser untergeht, und so hart ist, daß es mit Werkzeugen zur Metallbearbeitung bearbeitet werden muß, deutlich biegesteifer als das weitverbreitete Palisander ("Rosewood") oder als Ahorn. Und vergleichen Sie mal den Hals einer Les Paul mit dem einer Stratocaster! Die effektiv wirksame Halslänge einer Les Paul ist erheblich geringer als bei einer Stratocaster, weil er viel früher in den Korpus übergeht und zudem seine Dicke schon ein gutes Stück vorher auf Korpusdicke zunimmt. Darunter leidet einerseits die Bespielbarkeit auf hohen Bünden, aber es sorgt andererseits für das legendäre Sustain. Leider halten sich nicht nur die o.g. unzutreffenden Gerüchte hartnäckig, weil im Handel keine absolut baugleichen E-Gitarren angeboten werden, die sich wirklich nur durch ein einziges Detail wie z.B. ein anderes Holz für den Korpus unterscheiden. Vielmehr wird oft Gitarre A mit Gitarre B verglichen und der klangliche Unterschied vor allem auf ein besonderes Detail zurückgeführt ohne zu berücksichtigen, daß es noch viel mehr konstruktive Unterschiede gibt, von denen viele zudem nicht augenscheinlich aber klangbestimmend sind. Um es einmal anhand eines Vergleichs zu sagen: Wenn man nicht so genau weiß, wie Autos funktionieren, könnte man auf die Idee kommen, daß ein Porsche Turbo vor allem wegen seines großen Heckspoilers schneller fährt als ein VW Golf, da der ahnungslose Beobachter den eminent wichtigen Motor gar nicht sieht. Genauso lächerlich wie dieses Beispiel ist leider auch so manche Argumentation von Klangunterschieden. Sehr oft wird beispielsweise die Gibson Les Paul mit der Fender Stratocaster verglichen, wobei die tatsächlich vorhandenen Klangunterschiede meistens mit dem Korpusmaterial (Mahagoni mit Ahorndecke statt Esche bzw. Erle) begründet werden. Daß bei der überwiegenden Mehrheit der Les-Paul-Modelle Humbucker statt Single Coils verbaut sind, diese an einer ganz anderen Position sitzen und sowohl eine andere Resonanzfrequenz als auch Güte besitzen, der Hals bei den meisten Les-Paul-Modellen aus Mahagoni statt Ahorn besteht und effektiv deutlich kürzer ist, die Brücke ganz anders konstruiert ist, die Mensur kürzer ist und vieles Andere mehr, wird gern unterschlagen oder vernachlässigt. Ähnlich ist es, wenn die Diskussion z.B. um die Brückenkonstruktion geht; es wird dann nämlich gern argumentiert, daß eine Les-Paul-Brücke weich klingt und eine Stratocaster-Brücke aggressiv, weil eben eine Les Paul weicher klingt als eine Stratocaster. Der ganze Rest wird dann einfach ignoriert. Wer denkt schon gern darüber nach, daß bei einer Stratocaster die Brücke, die ja per Hebel eine Tonhöhenänderung ermöglicht (Vibrato-Hebel, oft fälschlich Tremolo-Hebel genannt), von einer Federkonstruktion in Position gehalten wird und daher in direkter und ungefilterter Wechselwirkung mit der Saitenschwingung steht, wo es sich doch so herrlich und sinnfrei über Hölzer bzw. Metalle sinnieren läßt? Die ab Werk 3 Federn bilden mit der Brücke ein schwingfähiges System mit 3 normalerweise dicht zusammenliegenden Resonanzfrequenzen und werden vom Saitenzug, der sich ja im Takte der Saitenschwingung ändert, zum Schwingen angeregt. Diese Schwingung wirkt seinerseits natürlich direkt auf die Saitenschwingung, und zwar ganz massiv. Die Resonanzfrequenz dieser Federkonstruktion können Sie sehr leicht hör- und fühlbar machen, indem Sie z.B.die Gitarre in einer Hand halten und mit dem weichen Handballen der anderen auf den Korpus klopfen; bei Schwingungsanregung mit einem Knöchel (d.h. so, wie wenn man an eine Tür klopft) würden die lauten Anschlagsgeräusche die Schwingung der Federn übertönen. TonabnehmerBei den Tonabnehmern hat sowohl der mechanische Aufbau als auch die Anordnung auf der Gitarre (Abstand vom Steg!) und die äußere Beschaltung sehr großen Einfluß auf den Frequenzgang und daher den Klang. In den Anfängen der elektrisch verstärkten Musik benötigte man relativ viel Spannung, um einen Verstärker ordentlich auszusteuern. Deshalb hatte es sich eingebürgert, daß Gitarrentonabnehmer sehr viele Windungen aus extrem dünnem Draht erhielten (je mehr Windungen desto höhere Spannung). Üblich waren und sind heute noch zwischen 5000 undIn  Bild 4: Ersatzschaltbild eines Tonabnehmers Elektrotechnisch nicht so ganz Versierte werden sich möglicherweise wundern, daß in dem Ersatzschaltbild ein Generator, also eine Spannungsquelle, auftaucht. Im Grunde ist jedes noch so kleine Stück des Wickeldrahtes ein Generator, weil auch in sehr kurzen Drahtabschnitten eine Spannung induziert wird, so daß es physikalisch gesehen unendlich viele kleine Generatoren gibt. Da sich die Reihenschaltung mehrerer kleiner Generatoren aber genauso verhält wie ein großer, darf man sie als Ersatzschaltbild als ein großer zusammenfassen. Genauso verhält es sich mit der Induktivität, dem Wicklungswiderstand und der Wicklungskapazität. Aufgrund der nicht zu vermeidenden Dämpfung (Dämpfungswiderstand und auch Drahtwiderstand) wird der Tonabnehmer selbstverständlich nicht anfangen, von sich aus zu schwingen, aber er sorgt für eine höhere Ausgangsspannung in der Nähe der Resonanzfrequenz, die sogenannte Resonanzüberhöhung. Unter gitarrenüblicher Belastung sind als Resonanzfrequenz etwa 2 bis 5 kHz üblich mit einer Resonanzüberhöhung zwischen 0 und 20 dB, was den charakteristischen Klang ergibt. In  Bild 5: Typische Frequenzgänge von Tonabnehmern Der relativ weiche Klang einer Gibson Les Paul kommt durch die relativ niedrige Resonanzfrequenz in Verbindung mit einer nur geringen Resonanzüberhöhung zustande, während die höhere Resonanzfrequenz einer Fender Stratocaster einen insgesamt härteren und die im unbedämpftem Fall sehr hohe Resonanzüberhöhung gleichzeitig einen sehr schneidenden Klang ergibt. Der typische, metallische Fender-Sound entsteht beispielsweise bei ungefähr Fast immer wird die Klangerzeugung als Geheimwissenschaft dargestellt und als Beleg dafür dargelegt, daß sich z.B. Magnetmaterial, Drahtdurchmesser, Isoliermaterial des Drahts und Windungszahl auf den Klang auswirken. Dies ist zwar absolut richtig aber noch lange kein Mysterium und sogar recht leicht berechenbar, wenn man (wie der Hersteller) die Daten zur Verfügung hat: Die Anzahl der Windungen beeinflußt Induktivität und Kapazität, das Isoliermaterial und dessen Dicke nur die Kapazität und der Magnet durch seine Permeabilität nur die Induktivität. Ob von Hand oder maschinell gewickelt wird, ist ebenfalls wichtig. Denn von Hand bekommt man keine saubere Wicklung hin, d.h. die Windungen liegen nicht geordnet nebeneinander sondern sind wirr durcheinander, was in der Regel eine geringere Wicklungskapazität ergibt. Leider ist dabei aber kein Tonabnehmer wie der andere, weil man von Hand nicht zweimal das absolut gleiche Wirrwarr zustande bringen kann. Wenn man wollte, könnte man dies zwar auch maschinell optimieren und die geringstmögliche Kapazität erreichen, was z.B. bei Hochfrequenzspulen für Radioempfänger (sogenannte Kreuzwickelspulen) systematisch und 100% reproduzierbar gemacht wird. Dazu besteht aber keine Notwendigkeit, da eine bestimmte Wicklungskapazität durchaus erwünscht ist. Daß bei sauber gewickelten Kreuzwickelspulen aufgrund der durch die Wickeltechnik erzeugten Abstände zwischen den Windungen deutlich weniger Windungen im gleichen Wickelraum untergebracht werden können, ist ohnehin ein Man kann Induktivität, Widerstand und Kapazität über die Anzahl der Windungen, Drahtdicke, Isoliermaterial, Magnetmaterial etc. so einstellen, daß sich bei vorgegebener äußerer Belastung der richtige sprich der gewünschte Klang ergibt und dann eine Menge Gerüchte über die Gründe für den tollen Klang in die Welt setzen. So machen es die Gitarren- bzw. Pickup-Hersteller, die damit bezwecken, bei Ihnen den Glauben zu erzeugen, daß der Klang ihrer Produkte auf einem großen Geheimnis beruht, d.h. daß Sie garnicht erst auf die Idee kommen, den für deren Produkte bekannten Klang woanders kaufen zu wollen. Man kann aber auch einen beliebigen Tonabnehmer wie in Keramikmagneten (richtig heißen diese Magnete übrigens Ferritmagnete, siehe Damit keine Mißverständnisse entstehen: Auch wenn das Magnetmaterial selbst nicht klangprägend ist, besitzt es jedoch eine sogenannte relative Permeabilität, deren Wert bei vielen Materialien, die man zur Magnetherstellung verwendet, bei 1 oder nur knapp darüber liegt. Dies bedeutet, daß ein Magnet mit Permeabilitätszahl 1 zwar ein Magnetfeld zur Verfügung stellt, sich in einer Spule ansonsten aber wie Luft verhält. Tauscht man solche Magnete gegen solche mit höherer Permeabilitätszahl aus (z.B. AlNiCo), steigt natürlich die Induktivität, wodurch die Resonanzfrequenz sinkt. Aufgrund der Tatsache, daß es sich lediglich um eine Spule mit Kern handelt, d.h. mit einem sehr großen Luftspalt (nämlich vom Südpol bis zum Nordpol) anstatt eines komplett ferromagnetisch geschlossenen magnetischen Kreises, nimmt die Induktivität weit weniger zu, als es der Zahlenwert der Permeabilität vermuten läßt. Der Induktivitätsanstieg ist also relativ gering, was die Resonanzfrequenz ein wenig sinken läßt, was wiederum den Tonabnehmer etwas weicher klingen Ganz großes Kino sind übrigens "aged magnets," zu deutsch gealterte Magnete. Unter diesem Oberbegriff verbergen sich verschiedene Maßnahmen, die entweder einzeln oder zusammen angewendet werden, um ahnungslosen Gitarristen Geld aus der Tasche zu ziehen: Einerseits kann man das Magnetmaterial (wir sprechen hier vorzugsweise von AlNiCo) bei relativ hoher Temperatur lagern, um es künstlich zu altern. Schon neues AlNiCo wird stets künstlich gealtert, damit dieses stabile Eigenschaften bekommt. Die Idee hinter der weiteren Alterung ist, das gleiche Verhalten zu bekommen wie die ursprünglichen Vintage-Tonabnehmer aus den Gitarren der 50er oder 60er Jahre, die man sich als Normalverdiener nicht leisten kann. Man kann die alternativ zum künstlichen Altern aber auch gleich bei der Herstellung weniger stark magnetisieren, um das eigentlich sehr unerwünschte Verhalten von AlNiCo zu simulieren, daß es sich mit der Zeit im Umfeld anderer Magnetfelder langsam entmagnetisiert. Aufgrund des weniger starken Magnetfelds liefert der Tonabnehmer eine etwas geringere Ausgangsspannung. Zusätzlich sorgt die geringere Magnetisierung für eine etwas höhere Permeabilitätszahl, was eine geringfügig höhere Induktivität und damit eine niedrigere Resonanzfrequenz nach sich zieht, welche wiederum einen geringfügig weicheren Klang ergibt. Viel einfacher und variabler kann man diesen weicheren Klang aber durch einen kleinen Kondensator erzielen (wie in Reglereinstellung / KabelkapazitätVielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß Ihre E-Gitarre einen anderen Klang besitzt, wenn Sie den Lautstärkeregler an der Gitarre voll aufdrehen und den Verstärker entsprechend runterregeln, als wenn Sie die Laustärke an der Gitarre reduzieren und den Verstärker weiter aufdrehen, um eine gleiche Laustärke zu erhalten. Dies liegt nicht an ihrem Verstärker sondern daran, daß auch z.B. das Kabel zwischen Gitarre und Verstärker eine geringe Kapazität darstellt, die bei entsprechender Reglereinstellung parallel zur Wicklungskapazität der Pick-Ups liegt und damit die Resonanzfrequenz erniedrigt. Dies gilt natürlich nicht für Elektrogitarren mit sogenannter "aktiver Elektronik". ist Ihnen aufgefallen, daß Ihre E-Gitarre einen anderen Klang besitzt, wenn Sie den Lautstärkeregler an der Gitarre voll aufdrehen und den Verstärker entsprechend runterregeln, als wenn Sie die Laustärke an der Gitarre reduzieren und den Verstärker weiter aufdrehen, um eine gleiche Laustärke zu erhalten. Dies liegt nicht an ihrem Verstärker sondern daran, daß auch z.B. das Kabel zwischen Gitarre und Verstärker eine geringe Kapazität darstellt, die bei entsprechender Reglereinstellung parallel zur Wicklungskapazität der Pick-Ups liegt und damit die Resonanzfrequenz erniedrigt. Dies gilt natürlich nicht für Elektrogitarren mit sogenannter "aktiver Elektronik".Somit ist es auch kein Märchen, daß die Gitarre bei Verwendung eines anderen oder eines längeren/kürzeren Kabels (mit einer anderen Kapazität!) auch tatsächlich anders klingt. Der mit einem bestimmten Kabel erzielte gute Klang ist allerdings nicht Resultat eines besonders hochwertigen Kabels, sondern läßt sich absolut identisch mit jedem beliebigen anderen Kabel erzielen, indem man die Länge so wählt, daß die Kabelkapazität gleich ist. Der ohmsche Widerstand und die Induktivität des Kabels sind übrigens derart gering, daß sie in keinster Weise wirksam werden. Mit einem im Elektronikhandel erhältlichen Meßgerät (sogenanntes Multimeter), das über die Möglichkeit der Kapazitätsmessung verfügt, kann man die Kabelkapazität leicht messen. Sie liegt üblicherweise im Bereich einiger hundert Picofarad bis hinein in den Nanofaradbereich. Man kann den Klang sogar mit Hilfe des Lautstärkepotentiometers beeinflussen. Dieser Effekt ist dadurch begründet, daß die Kabelkapazität bei voll aufgedrehtem Lautstärkepoti parallel zum Tonabnehmer liegt und sich somit zur Tonabnehmerkapazität dazuaddiert, was eine niedrigere Resonanzfrequenz ergibt, wobei die Resonanzüberhöhung erhalten bleibt. Dreht man die Lautstärke an der Gitarre hingegen zurück, sind Kabel und Tonabnehmer nicht mehr direkt sondern über den je nach Potistellung mehr oder minder großen Widerstand des Potis voneinander entkoppelt. Diese Entkopplung funktioniert umso besser, je leiser die Einstellung ist. Man kann so gegenüber der Einstellung "volle Lautstärke" eine höhere Resonanzfrequenz erzielen, wobei auch hier bei geschicktem Einsatz die Resonanzüberhöhung erhalten bleibt. Allerdings kann man dann am Gitarrenverstärker den Lautstärkeverlust oft nicht mehr kompensieren, weil dieser keine so hohe Verstärkung ermöglicht, und das Rauschen nimmt natürlich auch kräftig zu. Wenn einem trotz dieser Widrigkeiten dieser Klang gefällt, empfiehlt sich der Einbau eines Vorverstärkers in die Gitarre, der sogar noch etwas mehr Resonanzüberhöhung ermöglicht, keine Lautstärkereduktion erfordert und auch das Rauschen nicht erhöht. Bei allen anderen Reglereinstellungen als "volle Kanne" oder "extrem leise" muß man jedoch speziell bei hoher Kabelkapazität sprich langem Kabel mit einem mehr oder weniger dumpfen Klang rechnen. Der Grund dafür ist, daß der Widerstand des Potis zusammen mit der Kabelkapazität einen Tiefpaß mit variabler Frequenz bildet, der einerseits seiner Natur entsprechend hohe Frequenzen dämpft und andererseits zusätzlich den Tonabnehmer belastet sprich die Resonanzüberhöhung reduziert. Der Tiefpaß hat seine niedrigste Grenzfrequenz d.h. dämpft hohe Frequenzen am meisten, wenn die beiden Widerstände zwischen Schleiferabgriff und den beiden anderen Anschlüssen gleich sind. Dies ist nicht, wie man meinen könnte, bei Einstellung auf Anordnung der TonabnehmerWenn Ihre Elektrogitarre mehrere baugleiche Tonabnehmer besitzt, produziert der stegnahe einen anderen Klang als der nahe am Griffbrett positionierte. Die Ursache liegt darin, daß die eigentliche Tonerzeugung durch die Saiten erfolgt und die Schwingungen an jeder Stelle der Saiten anders ist. Aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten bilden sich auf einer Saite stehende Wellen aus, und zwar neben der Grundwelle auch Obertöne sprich ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz. Um den Vorgang zu verstehen hier ein kurzer Ausflug in die Physik:Die Saite ist an beiden Enden fest eingespannt, an einer Seite am Steg und auf der anderen Seite am Hals bzw. an einem Bund durch Runterdrücken der Saite auf das Griffbrett. Sie kann sich daher dort überhaupt nicht bewegen. Die Grundwelle und damit der tiefste Ton wird dadurch gebildet, daß die Saite in der Mitte hin- und herschwingt, wie in
Vor diesem Hintergrund ist klar, daß ein Tonabnehmer, der in Höhe eines Schwingungsknotens sitzt, keinerlei Ausgangsspannung liefern kann. Es gibt aber immer Frequenzen, bei denen diese Bedingung mehr oder weniger gut erfüllt ist. Bei einem Tonabnehmer nahe am Steg bedarf es einer recht kurzen Wellenlänge d.h. hohen Frequenz, damit dort der erste Schwingungsknoten entsteht. Der "Frequenzgang" sieht so aus wie in  Bild 7a: Frequenzgang bei stegnahem Pick-Up  Bild 7b: Frequenzgang bei stegfernem Pick-Up Zusammenschaltung bzw. Typ der TonabnehmerBei vielen Elektrogitarren kann man mehrere Tonabnehmer zusammenschalten. Hierbei treten Interferenzerscheinungen auf, weil bei bestimmten Frequenzen ein Tonabnehmer ein gleichgroßes aber entgegengesetzt gepoltes Signal erzeugt wie ein anderer. In diesem Fall heben sich beide Signale auf. Dieser Effekt tritt auch bei den oben beschriebenen Humbucking-Pickups auf, weil es sich hierbei ebenfalls um die Zusammenschaltung von 2 Tonabnehmern handelt, wie dies in Bild 8: Auslöschung bei Zusammenschaltung SaitenAls Saiten kommen für Elektrogitarren präzise gefertigte Drähte aus ferromagnetischem Material zum Einsatz, fast ausnahmslos Nickel und Stahl. Für die tiefer klingenden Saiten wäre ein dicker nackter Draht allerdings nicht flexibel genug, denn dicke Drähte lassen sich schlecht biegen, was sich in einem unsauberen Klang bemerkbar machen würde. Auf der anderen Seite muß die Masse der tiefen Saiten ausreichend hoch sein, damit man die Saitenspannung in einem akzeptablen Rahmen halten kann. Aus diesem Grund sind die tiefen Saiten zur Erhöhung der schwingenden Masse zusätzlich mit einem dünneren Draht bewickelt. Eine Besonderheit sind mit halbrundem Draht bewickelte Saiten ("geschliffene" Saiten), die beim Umgreifen nicht quietschen und daher vor allem für nicht so geübte Gitarristen zu empfehlen sind. Die Quietschgeräusche kommen nämlich daher, daß die Bewicklung für eine in Längsrichtung "wellige" Oberfläche sorgt. Da der Durchmesser des Wickeldrahts und der Abstand der Fissuren (das sind die feinen Rillen eines Fingers, die die Fingerabdrücke ergeben) in der gleichen Größenordnung liegen, verhaken sich beide ganz leicht, wenn man den Finger in Längsrichtung mit ganz leichtem Druck über die Saiten bewegt. Dadurch wird die Saite zur Schallabstrahlung angeregt, was man in ähnlicher Weise auch erreichen kann, wenn man das Plektrum längs über die Saite zieht. Das Geräusch kann man dadurch vermindern bzw. nahezu ganz vermeiden, indem man für eine Oberfläche sorgt, in der sich die Fissuren nicht verhaken können. Dies wird durch den halbrunden Draht erreicht, wobei die flache Saite natürlich außen sein muß.Nach diesem kleinen Exkurs weiter im Text: Es gibt unzählige Marken und noch viel mehr Ausführungsformen von Saiten. Je dicker eine Saite ist, desto höher muß der Zug (d.h. die Kraft, mit der sie gespannt wird) sein, damit sie unter sonst gleichen Bedingungen die gleiche Frequenz erzeugt wie eine dünnere. Eine dickere Saite schwingt langsamer aus als eine dünne, weil bei gleicher mechanischer Schwingungsamplitude durch die höhere Masse mehr Energie in der schwingenden Saite steckt, die per Luftreibung, Reibung in der Saite etc. langsam abgebaut wird. Gleichzeitig nimmt die Amplitude der Oberschwingungen aber schneller ab als bei einer dünnen Saite, weil eine dicke Saite sich schwerer biegen läßt und mit zunehmender Frequenz die Biegeverluste zunehmen. Durch die weniger starken Oberwellen klingen dicke Saiten voller und weicher, was für manche Sounds durchaus erwünscht ist, für andere sich aber negativ auswirkt. Im Gegenzug lassen sich dünne Saiten besser "ziehen", d.h. man kann durch seitliches Verschieben auf dem Bund leichter und extremer die Tonhöhe ändern. Deshalb bieten viele Hersteller unterschiedlich dicke Saitensätze an, wobei es auch solche gibt, bei denen die Baßsaiten besonders dick und die für die hohen Töne besonders dünn sind ("light top and heavy bottom") oder umgekehrt. Die Saiten haben einen relativ großen Einfluß auf den Grundklang der E-Gitarre, weshalb man ihnen genügend Aufmerksamkeit widmen sollte. Allerdings ist es auch so, daß die Saiten umso unwichtiger werden, je verzerrter die Gitarre gespielt wird bzw. je mehr der Klang anderweitig verfremdet wird. Wenn Sie einen unreinen Klang bemängeln (ohne Übersteuerung!), können daran durchaus die Saiten Schuld haben, die möglicherweise ungleich bewickelt sind. Es kann aber auch sein, daß die Tonabnehmer einfach nur zu nah an den Saiten montiert sind und mit ihrem starken Magnetfeld die Schwingung negativ beeinflussen sprich die Saiten versuchen, mit ihrem Magnetfeld "festzuhalten". Dann hilft es, die Tonabnehmer so einzustellen, daß sie weiter von den Saiten entfernt sind. Oft klagen Gitarristen auch über einen wenig brillianten Klang. Außer dem Tonabnehmer incl. kompletter Wiedergabekette bis hin zum Lautsprecher kann dies ebenfalls an den Saiten liegen. Abgesehen davon, daß es schlechte Saiten gibt, altern auch qualitativ hochwertige Saiten infolge Korrosion und Verschmutzung. Folge ist eine höhere Dämpfung, die sich insbesondere auf hohe Frequenzen auswirkt, wodurch die Saiten matt und farblos klingen. Bevor Sie anfangen, die Tonabnehmer auszutauschen oder sonst etwas zu ändern, sollten Sie erst einmal neue Saiten ausprobieren, ggf. mehrere unterschiedliche Typen. Dabei muß der von einem bekannten Gitarrenhelden in der Werbung schmackhaft gemachte Hersteller und Saitentyp nicht unbedingt zum Charakter Ihrer eigenen Gitarre oder Ihrer eigenen Spielweise passen. Ob er diesen Saitentyp tatsächlich selbst in der täglichen Praxis verwendet, ist ohnehin fraglich, denn er macht die Werbung schließlich nicht, weil er von dem Produkt dermaßen überzeugt ist, daß er missionarische Ambitionen hegt, sondern schlicht und ergreifend, weil die betreffende Firma ihn dafür direkt oder indirekt bezahlt. Viele Diskussionen werden über das Material der Saiten geführt: Das eher altmodische und warm klingende Nickel oder der härtere und daher brillianter klingende Edelstahl. Klar kann man im direkten Vergleich Unterschiede hören, aber erstens kann man das auch bei Saiten aus dem gleichen Material aber unterschiedlichen Herstellern und zweitens sind sie nicht so hoch, daß es sich lohnt, dafür Glaubenskriege anzuzetteln. Abgesehen vom Klang, der m.E. einfach Geschmackssache ist, haben beide Materialien noch andere Vor- und Nachteile. Edelstahl ist korrosionsstabiler als Nickel, aber leider auch härter als Neusilber, welches das übliche Material ist, aus dem die Bünde gefertigt sind. Deshalb ist die Lebensdauer der Bünde bei Verwendung von Edelstahlsaiten begrenzt, speziell natürlich bei Leuten, die nicht so fest wie nötig greifen sondern so fest wie möglich. Nickel ist hingegen ein Material, das allergologisch nicht unbedenklich ist, und man bekommt beim Spielen auch bei schon lange in Gebrauch befindlichen Saiten durch den Metallabrieb immer schwarze Fingerkuppen. Nickel ist gleichzeitig weicher als die Bünde, weshalb letztere deutlich länger halten. Im Umkehrschluß muß man Nickelsaiten öfter wechseln als Edelstahlsaiten. Falls Sie Nickelsaiten bevorzugen, sollten Sie aufpassen, daß Sie keine mit einer dünnen Nickelschicht beschichtete Edelstahlsaiten kaufen. Diese haben nämlich die Nachteile beider Welten, ohne auch nur einen einzigen Vorteil zu bieten. Achten Sie daher darauf, daß vom Hersteller angegeben ist, daß die Saiten in Gänze aus Nickel bestehen ("pure nickel"). Die alleinige Bezeichnung "nickel strings" ist dafür nicht ausreichend. WiedergabeketteBislang wurden diejenigen Komponenten betrachtet, aus denen eine E-Gitarre besteht. Im Gegensatz zu einer akustischen Gitarre gehören bei einer E-Gitarre Verstärker und Lautsprecher jedoch mit zum Instrument, weil beide stark damit zu tun haben, welcher Klang letztendlich hinten herauskommt: Ein Verstärker kann beispielsweise linear betrieben werden oder aber verzerrend, wodurch im letzten Fall u.U. unzählige weitere Oberwellen künstlich erzeugt werden, während die Oberwellen der Gitarre umso mehr unterdrückt werden, je stärker übersteuert wird. Und der Lautsprecher hat meistens einen ziemlich krummen Frequenzgang, der für Elektrogitarren eher mittenbetont ist mit meistens nicht allzuviel Baß, einer mehr oder weniger ausgeprägten Resonanzstelle im Bereich vonResümeeVon den beeinflußbaren Elementen haben (abgesehen von den Saiten) die Tonabnehmer, die gitarreninterne Verschaltung und die Kombination aus Verstärker und Lautsprecher den größten Einfluß auf den Klang. Deshalb sollten Sie zuerst einmal genau hier ansetzen, wenn Sie mit dem Klang Ihrer Gitarre nicht zufrieden sind. Sie müssen aber nicht unbedingt gleich einen neuen Verstärker kaufen, wenn Sie mit Ihrem nicht zufrieden sind. Betreiben Sie ihn einfach im linearen Bereich (d.h. ohne Verzerrung), sofern die Laustärke ausreicht, und überlassen Sie die Erzeugung der Oberwellen einem vorgeschalteten Effektgerät, das Sie noch nicht einmal kaufen müssen sondern mit ein wenig bastlerischem Geschick für wenig Geld selbst bauen können. Bauanleitungen finden Sie im Internet sehr zahlreich.Auch ist der normalerweise gern praktizierte Austausch der Tonabnehmer oft nicht nötig. In den meisten Fällen ist lediglich die elektrische Innenverschaltung Ihrer E-Gitarre derart simpel und entgegen allen elektrotechnischen Grundsätzen ausgeführt, daß die Tonabnehmer einfach nur falsch belastet werden und ihre klanglichen Eigenschaften überhaupt nicht zum Tragen kommen. Hier bietet sich ein Totalumbau an, der viel einfacher durchzuführen ist, als Sie jetzt vielleicht denken. Eine zu niedrige Resonanzfrequenz und/oder zu geringe Resonanzüberhöhung läßt sich oft mit relativ einfachen Mitteln korrigieren. In Eins sollten Sie jedoch bei aller Technik nicht vergessen: Den mit weitem Abstand größten Einfluß darauf, ob eine Elektrogitarre gut oder schlecht klingt, hat derjenige, der unmittelbar hinter ihr steht. Denn wenn ein begnadeter Gitarrist auf einer 100-Euro-Gitarre spielt, klingt es immer um Welten besser, als wenn ein Anfänger z.B. auf einer der legendären und inzwischen unbezahlbaren 57er | |||||||||||||||||||
 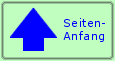 |
Alle Angaben in Zusammenhang mit dieser Site wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Trotzdem kann hierfür keine Haftung übernommen werden. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Chr. Caspari (sofern nicht anders gekennzeichnet). Es gelten die allgemeinen Mitteilungen über Fehler sind stets willkommen (Kontaktmöglichkeiten siehe Letztes Update dieser Seite: 01.10.2023 (Untergeordnete Seiten können aktueller sein) |